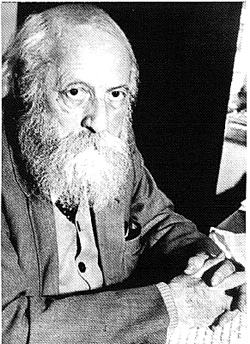
Eine allzu unchristliche Bibel - Franz Rosenzweig und Martin Buber als Bibelübersetzer
von Stefan Schreiner
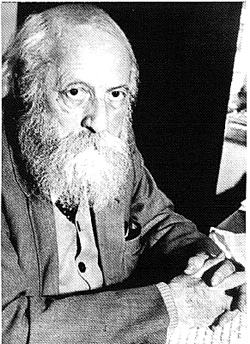
Martin Buber

Franz Rosenzweig
Wenige Monate nach Franz Rosenzweigs Tod - er war am 10. Dezember 1929 gestorben; er und Buber waren gerade mit der Übersetzung von Jesaja 53 beschäftigt - veröffentlichte Martin Buber unter dem Titel Aus den Anfängen unsrer Schriftübertragung eine erste Rechenschaft über die Prinzipien, die Rosenzweig und ihn bei ihrer gemeinsamen Schriftübertragung leiteten, über die Arbeitsweise Lind über die wachsende gegenseitige Befruchtung im Verstehen und Verständlichmachen der Schrift.
Darin berichtet Buber über den Anfang des agemeinsamen Unternehmens u. a.: Als er, Buber, Anfang 1925 von dem ihm bis dahin unbekannten christlichen Verleger Lambert Schneider die Anfrage bekommen habe, ob er bereit sei, eine Übersetzung des Alten Testaments zum Druck vorzubereiten, gleichviel ob eine Neuherausgabe, eine Bearbeitung oder ein eigenes Werk, habe er nach Rücksprache mit Franz Rosenzweig unter der Bedingung zugesagt, dass Rosenzweig mitmachen wird.
Die Anfrage als solche kam für beide indessen nicht überraschend. Hatten sich beide doch schon unabhängig voneinander, im Kreise von Freunden sowie untereinander, mit der Frage einer neuen Übersetzung der Schrift auseinandergesetzt. Insbesondere in den Jahren 1922/23 - Rosenzweig war zu jener Zeit mit der Übersetzung von Hymnen und Gedichten Jehuda ha-Lewis beschäftigt und hatte sich dabei des öfteren ratsuchend an Buber gewandt - war diese Frage, die Übersetzung der Schrift, wie Buber bekennt, die magnetische Mitte des Gespräches zwischen den Freunden geworden: "Ist die Schrift übersetzbar? Ist sie schon wirklich übersetzt? Was bleibt noch zu tun? Wenig? viel? das Entscheidende?... Und über alles: wie ist die Schrift zu übersetzen? Wie ist sie in diesem Zeitalter zu übersetzen?"
Die Kunst, ZWEI HERREN ZU DIENEN
Das waren die Fragen, um die es ging, und sie brachen mit um so grösserem Nachdruck auf, je mehr sich Buber und vor allem Rosenzweig mit dem Problem des Übersetzens überhaupt befassten, einer Aufgabe, die völlig missverstanden wäre, wollte man sie als "Eindeutschen des Fremden" beschreiben und verstehen. Rosenzweig nannte Übersetzen die Kunst, "zwei Herren zu dienen", nämlich der Sprache, aus der übersetzt, und der Sprache, in die übersetzt wird. Eine Übersetzung ist folglich nur dann wirklich gelungen, wenn sie - mit Rosenzweig zu reden - die "Vermählung zweier Sprachgeister" zuwege bringt bzw. gebracht hat.
Rosenzweigs und Bubers Theorie des Übersetzens im einzelnen nachzuzeichnen ist hier nicht der Ort, so interessant dies auch wäre; denn beide haben sie sich davon immer wieder neu, ja permanent, Rechenschaft gegeben. Dies ist ihren Arbeitspapieren zur Verdeutschung der Schrift und den mit der Übersetzung, entstandenen Aufsätzen Seite um Seite zu entnehmen, die sie wenige Jahre später unter dem Titel Die Schrift und ihre Verdeutschung (1936) veröffentlichten. Die Grundfrage bei allem Übersetzen ist das "Wie" des Übersetzens. Wie soll man übersetzen? Hatte nicht einst Rabbi Jehuda bereits gelehrt: "Wer einen Schriftvers wörtlich übersetzt, ist ein Lügner, und wer hinzufügt, ist ein Verleumder und Gotteslästerer" (bQidd 49a)?
Noch als Buber und Rosenzweig 1925 daran gingen, die gemeinsame Arbeit der Schriftübertragung zu beginnen, war Rosenzweig zutiefst überzeugt, dass Luthers Übersetzung die Grundlage für alle Versuche in deutscher Sprache sein müsse, dass also keine Neuübertragung, sondern nur eine Luther-Revision unternommen werden könne, wenn auch eine unvergleichlich umfassendere und eindringendere als alles, was bisher so bezeichnet worden ist. Buber war da anderer Meinung. Rosenzweig sah in Luthers Übersetzung des Alten Testaments jedoch jene "Vermählung der beiden Sprachgeister" geleistet, die eine wirkliche Übersetzung auszeichnet.
So begannen denn Buber und Rosenzweig, einen "jüdisch-revidierten Luthertext" zu versuchen. Aber bereits nach einem Tag Arbeit - gestand Buber - "standen wir vor einem Trümmerhaufen. Es hatte sich erwiesen, dass man auf diesem (Revisions-)Weg nirgends hinkam. Es hatte sich erwiesen, dass Luthers Altes Testament in alle Dauer ein herrliches Gebild blieb, aber schon heute keine Übertragung der Schrift mehr war." Und das nicht nur aus Gründen der Philologie, wie Rosenzweig in seiner Abhandlung Die Schrift und Luther (1926) deutlich gemacht hat. Vielmehr hatte die eingehende Beschäftigung mit Luthers Übersetzung zutage gefördert, dass hier nicht nach dem Massstab der Philologie, sondern nach dem des Glaubens gearbeitet worden war:
"Luther hatte in der 'Analogie des Glaubens' die nie versagende Wünschelrute, die ihm an all den Stellen. wo das Alte Testament 'Christum trieb', aufzuckte. Wo es so für ihn, den Christen, lebendiges Gotteswort war, da, und nur da, da aber unbedingt, musste es wörtlich genommen werden und also auch in 'steifer' Wörtlichkeit übersetzt. Überall sonst, und das umfasste für ihn beim Alten Testament den grössten Teil des Textes, wo es nach der herrlichen Stelle der Vorrede auf das Alte Testament (resp. der Vorrede zum Deutschen Psalter) nur ein Bild und Exempel des Regiments und des Lebens ist, wie es 'zugeht, wenn es im Schwang gehet', lässt der Übersetzer (d. i. Luther), die hebräischen Worte fahren und spricht frei den Sinn heraus aufs beste Deutsch, so er kann'!"
Demgegenüber sahen es Buber und Rosenzweig als ihre philologisch gefasste Aufgabe an, "so weit als irgend möglich beim niassoretischen [dem überlieferten hebräischen] Text, als dem einzigen objektiv fassbaren [Text des Alten Testaments] zu verharren" und ihn in seiner ursprünglichen Gesprochenheit neu zum Sprechen zu brinuen, nur eben in einer anderen, der deutschen Sprache.
Das Prinzip des Leitwortstils
Buber meinte, in dem von ihm als "Leitwortstil" bekannten Strukturprinzip der biblischen Redetexte den Schlüssel gefunden zu haben, jene ursprüngliche Gesprochenheit des Wortes erneut hören lassen zu können, und Rosenzweig stimmte ihm darin zu. "Leitwortstil" bedeutet nach Buber die emphatische Wiederholung: "Es geht hierbei um das Bezogenwerden zweier oder mehrerer Textstellen, sei es im gleichen Abschnitt, in verschiedenen Abschnitten, sei es auch in verschiedenen Büchern, aufeinander durch Wiederholung von Wörtern, Wortstämmen, Wortgefügen, und zwar solcherweise, dass die Stellen im Verständnis des Hörers einander erläutern, die neugehörte die altbekannte verdeutlicht, aber auch diese die neue zulänglicher erfassen hilft."
Die Aufgabe des Übersetzers besteht demzufolge darin, die ursprüngliche Bedeutung eines Wortes, eines Wortstammes oder einer Wurzel auszugraben und eine ihr entsprechende in der Sprache zu finden, in die übersetzt wird, wurzelgleiche Worte also allenthalben durch wurzeluleiche wiederzugeben, um so die wechselseitige Bezogenheit auch in der Übersetzung offenbar, also den "Leitwortstil" auch in der Übersetzung erkennbar werden zu lassen.Wieweit das bei zwei so grundverschiedenen Sprachen wie Hebräisch und Deutsch überhaupt möglich ist, muss hier dahingestellt bleiben. Kein Geringerer als Mosche ben Maimon (Maimonides) hatte bereits solches Verfahren selbst im Blick auf die beiden immerhin verwandten Sprachen Hebräisch und Arabisch für unmöglich gehalten. In einem Brief an seinen Übersetzer Schemuel ibn Tibbon im provencalischen Lunel hatte er geschrieben:
"Wer aus einer Sprache in eine andere übersetzen will und sich vornimmt, ein bestimmtes Wort immer nur durch ein bestimmtes andres Wort wiederzugeben und die Ordnung der Abhandlung und die der Worte einzuhalten, der wird damit viel Plage haben, und es wird dabei eine zweifelhafte und verworrene Übersetzung herauskommen. Es ist nicht richtig, derart vorzugehen. Vielmehr muss sich der Übersetzer zuerst den Gedankengang klarmachen; darin soll er ihn so berichten und darstellen, dass er in der anderen Sprache verständlich und ganz klar wird. Das ist nicht zu erreichen, wenn er nicht manchmal die Folge des früher oder später Gesagten abändert, ein einziges Wort durch mehrere Worte, und mehrere durch ein einziges wiedergibt, manche Wendungen fortlässt und andere hinzufügt, bis der Gedankengang geordnet und ganz klar ist und der Ausdruck verständlich wird als ein der Sprache, in die übersetzt wird, gemässer."
Nach Mosche ben Maimons Empfehlung zu verfahren war Buber und Rosenzweig im Blick auf die hebräische Bibel aber unangemessen. So beim Übersetzen vorzugehen verbot nicht zuletzt ihr Verständnis von philologischer Treue gegenüber dem Text, der übersetzt wird.
Während Bubers Beitrag zum gemeinsamen Übersetzungswerk die Entdeckung des Strukturprinzips der hebräischen Redetexte war, lag Rosenzweigs Beitrag auf benachbartem Gebiet, wiewohl er anfänglich, dank seines engen Kontaktes zur traditionellen Exegese, nur die Rolle der gründlichen Muse spielen wollte. Am Ende jedoch ist es seinem Genius zu verdanken, dass das von Buber gefundene Prinzip konkretisiert und praktisch verwirklicht werden konnte. War er es doch, dem es gelungen ist, die ursprünglichen Wurzelbedeutungen und ihre deutschsprachigen Entsprechungen zu ringen. also gewisserinassen den Wortschatz der Buber-Rosenzweigschen Bibelübersetzung zu schaffen. Zu den genialen Lösungen, die Rosenzweig dabei gefunden hat, gehört zum Beispiel die Wiedergabe der Wurzel z-d-q durch wahr und nicht wie üblich durch recht, weswegen dann zaddiq nicht mehr mit der Gerechte, sondern der Bewährte wiedergegeben worden ist; ganz zu schweigen von den vielen der Sprache des Kultus und des Rechts entstammenden Begriffen.
Die folgenschwerste Entscheidung indessen ist Rosenzweigs Wiedergabe des Tetragramms. des vierbuchstabigen Gottesnaniens, den er nicht als Ausdruck eines Seins, sondern eines Daseins, eines Bei-uns-Seins verstanden wissen wollte, wie er in seinem berühmten Aufsatz Der Ewige - Mendelssohn und der Gottesname eingehend erläutert hatte. Und es war eben diese Deutung des Namens, die zu seiner Wiedergabe durch das Personalpronomen - je nach Kontext - in der 1., 2. oder 3. Person geführt hat, also ICH, DU oder ER. Diese Entscheidung, das Tetragramm nicht mit HERR wiederzugeben, sollte der christologischen Interpretation der hebräischen Bibel den Boden entziehen. "Denkt doch der Christ", schrieb Rosenzweig, "der liest, 'Der Herr ist mein Hirte' (Ps 23,1 ). nicht an den Vater, sondern an den Sohn!" Eben dies aber darf nicht geschehen; denn ein solches "Christuszeugnis" kennt die hebräische Bibel nicht. Daher müsse - so Rosenzweig - die Wiedergabe des Tetragramms in einer Weise erfolgen, die jedwede gedankliche Assoziierung von Kyrios und Christos beim Lesen ausschliesst, ganz zu schweigen von deren Gleichsetzung.
Zudem ist das Tetragramin, wie Rosenzweig in seiner Begründung zur Übersetzung von Ex 3,14 ausdrücklich feststellt, ohnehin kein Name, kein Göttername. Ex 3,14 sagt nichts von einer eigentlichen Enthüllung oder Offenbarung des Namens, sondern erzählt allein von einem Aufleuchten Seines Da-Seins, enthält also Seine Präsenzzusage, die die Präsenzzusage eines Gottes ist, der wohl zu den Menschen spricht, wie er von den Menschen angeredet werden kann - dies ist der Sinn der Wiedergabe des Tetragramms durch das Personalpronomen -, aber sich nicht entbirgt, sondern ein El hanistater ist (Jes 45,15), ein Gott, der im Geheimnis bleibt. Demgegenüber würde die Wiedergabe des Tetragramms durch Kyrios, der seit dem Neuen Testament mit dem Christos gleichgesetzt wird, einen - wie Rosenzweig sagt - entborgenen Gott, den die hebräische Bibel jedoch nicht kennt, suggerieren.
Mit dieser weitreichenden, theologisch wohl begründeten Entscheidung haben Buber und Rosenzweig deutlich machen und mit ihrer Bibelübersetzung dokumentieren wollen, dass die hebräische Bibel nicht das Alte Testament und schon gar kein christliches Buch ist. Über die Konsequenzen waren Sie sich sehr wohl im klaren. In einem Brief an einen Freund vom Dezember 1925 befürchtete Rosenzweig:
"Ich fürchte manchmal, die Deutschen [d. h. die Christen] werden diese allzu unchristliche Bibel nicht vertragen, und es wird die Übersetzung der heute ja von den neuen Marcioniten angestrebten Austreibung der Bibel aus der deutschen Kultur werden, wie Luthers die der Eroberung Deutschlands durch die Bibel war. Aber auch auf ein solches Golus Bowel [babylonisches Exil] könnte ja dann nach siebzig Jahren ein neuer Einzug folgen, und jedenfalls - das Ende ist nicht unsere Sache, aber der Anfang und das Anfangen."
Nach aussen hin hatte Rosenzweig mit seiner Befürchtung wohl nicht recht gehabt. Äusserlich mindestens brauchte Die Schrift keine siebzig Jahre auf ihren Wiedereinzug in die "deutsche Kultur" zu warten, wie all die Auflagen und Ausgaben belegen, die sie seit ihrer ersten Gesamtausgabe (1954-62) erlebte. Würden er und Buber sich aber auch ohne Einschränkung darüber freuen (können), dass ihre Übersetzung als so unchristlich offenbar nicht empfunden wird, wie ihrem Gebrauch selbst im christlichen Gottesdienst zu entnehmen ist? Buber und Rosenzweig wollten mit ihrer Übersetzung der Schrift zurück zur ursprünglichen Gesprochenheit des Wortes, eines Wortes, das gleichermassen Juden und Christen wohl angeht, aber Judentum und Christentum vorausgeht. Die Rückkehr zur ursprünglichen Gesprochenheit des Wortes sollte es neu vernehmbar werden lassen, um durchs Hinhören auf das Wort der Schrift jene Wahrheit wiederzuentdecken, an der beide, Juden und Christen, teilhaben.
aus: Lamed 3/98